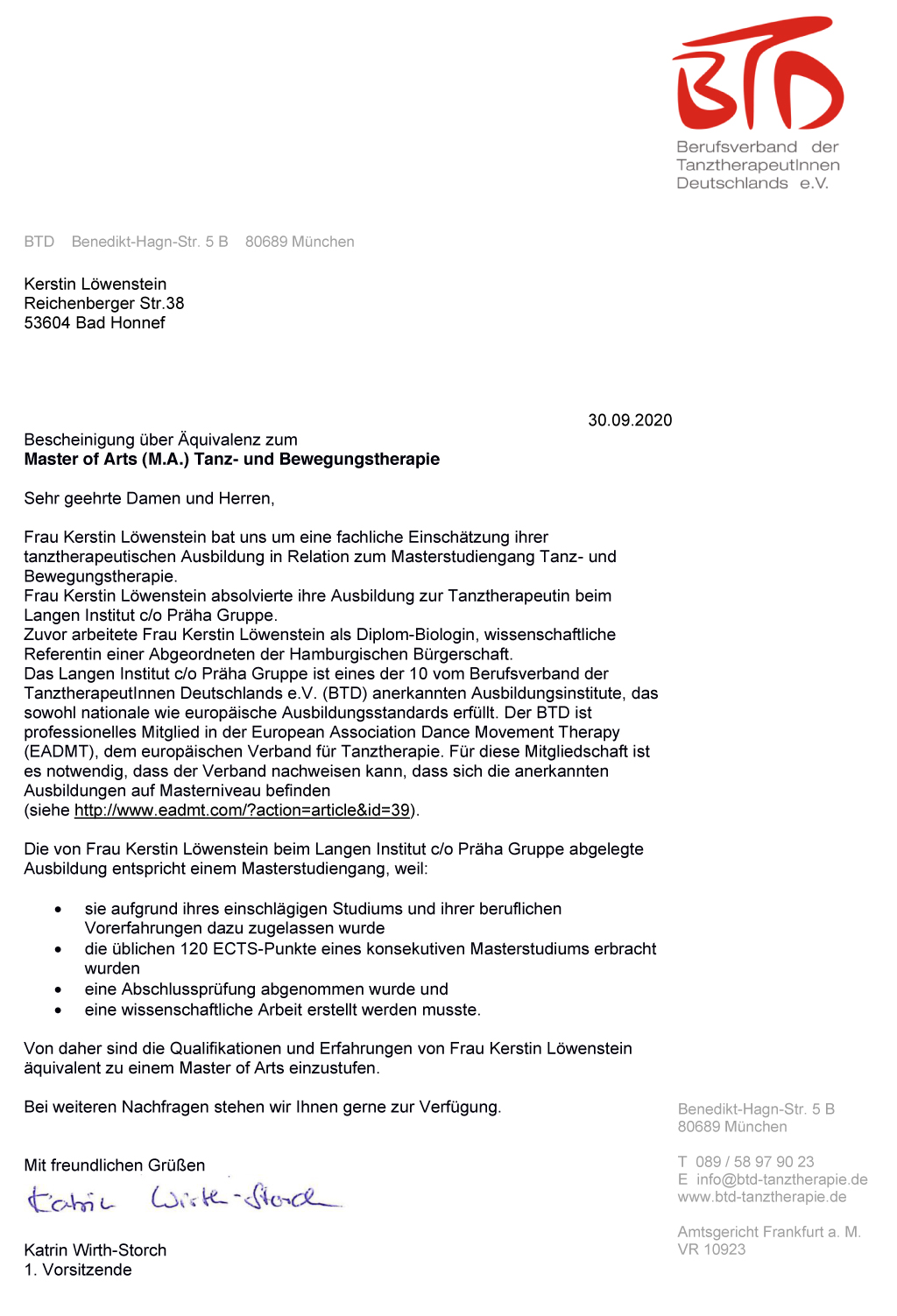Traumatische Erlebnisse
Psychische Traumata - Sinn von körperpsychotherapeutischen Interventionen
Einfache und komplexe Trauma-Folgestörungen benötigen ganzheitliche psychotherapeutische Unterstützung
Psychische Traumata entstehen durch äußere überwältigende Kräfte. Welche Spuren Traumata hinterlassen, wie die Psyche und wie zentrales und vegetatives Nervensystem, Immun- und Hormonsystem bei Traumatisierungen reagieren, wird von verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen erforscht (vgl. Egger 2008, Förstl 2006, Fogel 2013). Mir geht es darum, den Körper in psychotherapeutische Behandlungen bei traumatisierten Menschen einzubeziehen. Körperorientierte Methoden wie die Tanztherapie sprechen den Körper als Kommunikations- und Ausdrucksorgan an und ermöglichen einen umfassenden Umgang mit Traumata.
Während eines traumatischen Ereignisses wird extremer Stress im Körper aufgebaut, der sich manchmal erst Jahre später durch verschiedene Leiden manifestieren. Es gibt viele Überschneidungen der Symptome mit Angst-, Zwangs-, Suchterkrankungen, Depressionen und sogar Psychosen. Auch Probleme des Bewegungs- und Verdauungsapparats, chronische Schmerzen, wie z.B. Kopfschmerzen, Übererregbarkeit, Schlaflosigkeit, Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, geschwächte Immunität, hormonelles Ungleichgewicht, schweres prämenstruelles Syndrom (PMS) und Asthma können als langfristige Folgen von Traumatisierung auftreten.
Die von mir angebotenen Methoden wie Tanztherapie und Yoga bieten die Möglichkeit z.B. gespeicherte emotionale Energie kennenzulernen und freizusetzen und sich durch bewusste Atemübungen und achtsame Bewegung wieder mit dem Körper zu verbinden, vgl. Studienergebnisse des Biophysikers, Psychologen und Psychotraumnatologen Peter Levine und des niederländischen Psychiaters und des Traumaexperten Bessel van der Kolk. Letzterer konnte zeigen, dass zehn Wochen langes Üben von Yoga bei wöchentlichen, einstündigen Sitzungen sehr gute Wirksamkeit bei einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) hatte. Es reduzierte die PTBS-Symptome bei PatientInnen, die auf keine andere Behandlung oder Medikamente ansprachen. Weiteres siehe unten im Text sowie unter Downloads. Die im folgenden Text zitierten Quellen finden sie am Ende der Seite.
Verschiedene Ursachen von Traumata
Psychische Traumata (griechisch: Wunde) werden durch Überforderungen ausgelöst. Ereignisse, die meist plötzlich, unerwartet und unkontrollierbar eintreten, können die Betroffenen durch unerträgliche Informationen oder Reize bedrohen und überfluten, so dass die individuellen Bewältigungsstrategien versagen oder nicht ausreichen. Schwere Unfälle, Naturkatastrophen sowie sexuelle Gewalt, der plötzliche Verlust von Heimat oder von Angehörigen oder schwere Erkrankungen wie z.B. Herzinfarkt, Krebs, Schlaganfall können auslösend sein. Mit den sich mehrenden kriegerischen Auseinandersetzungen, mit Menschenhandel, Terrorattacken und Flüchtlingen in und aus vielen Ländern nehmen zwangsläufig auch Traumatisierungen zu.
Wenn man menschlicher Willkür ausgesetzt ist, können sich soziale Traumatisierungen entwickeln, auch ohne dass diese Einwirkungen plötzlich stattfinden. Diese Gefahr besteht insbesondere dann, wenn Willkür innerhalb von vertrauten Beziehungen herrscht. Der Traumaspezialist und psychologische Psychotherapeut G. Fischer (1999, S. 212) benannte als einer der ersten die weit gefasste Kategorie sog. Orientierungs- und Beziehungstraumata. Je vertrauter und enger Beziehungsverhältnisse zwischen Tätern und Opfern sind, umso komplexer und belastender werden traumatische Erlebnisse. Für Kinder sind Familiensituationen schwierig, wenn die Bedingungen für Schutz und Gefahr aus denselben Quellen kommen. Familien und andere Bindungssysteme sind zudem besonders traumatisierend, wenn die Realitätswahrnehmung und - damit eng verbunden - das klare und offene Sprechen über die Abläufe und die interne Kommunikation gestört ist. Wenn Paradoxien oder Widersprüche innerhalb der Bindungssysteme vorkommen, können sich Beziehungstraumata und bei Kindern in Folge auch Bindungsstörungen entwickeln. Orientierungstraumata resultieren aus ständig wiederkehrenden Erschütterungen des Selbst- und Weltverständnisses im Erwachsenenalter. Dass wiederholte Verletzungen von Werten, Idealen, Lebenseinstellungen und -zielen krank machen können, wird heute noch zu wenig bedacht. Von meinen Praxis-Erfahrungen leite ich ab, dass Menschen zunehmend derartige Erschütterungen erleben. Ein Beispiel ist eine in der Kindheit vortraumatisierte Patientin, die sich als Erwachse einer buddhistischen Gruppierung zuwendet und dort ehrenamtlich engagiert, indem sie bei Großveranstaltungen zentrale organisatorische und verantwortungsvolle Tätigkeiten übernimmt. Obwohl dort in den Mediationen der Wert des Mitgefühls als zentrales Ideal betont wird, sieht die Patientin sich über Monate hinweg von Mitarbeitern des Teams einem versteckten Mobbing ausgesetzt. Die Widersprüche zu entdecken, die Verletzungen zuzugeben und als Orientierungstrauma zu benennen, dies alles hilft ihr, die enorm an ihren Kräften zehrende Tätigkeit zu benenden..
No fight, no flight – dann folgt traumatische Fragmentierung!
Als Reaktionen auf Bedrohungen des Körpers oder der Psyche sind Kampf (fight) und Flucht (flight) natürlich. Beide Reaktionen gehen mit starken physiologischenVeränderungen einher. Wenn Kämpfen und Flüchten nicht helfen oder unmöglich sind (no fight, no flight), dann bleibt - um der Bedrohung zu entkommen - nichts anderes übrig, als mit Lähmung bzw. Einfriernen von Handlungsmustern (freeze) oder Spaltung (fragment) zu reagieren. Dadurch erst entstehen die eigentlichen Traumata. Eine Flut von Stresshormonen, z. B. von Noradrenalin, sowie von schmerzbetäubenden, körpereigenen Opiaten (Endorphinen) soll rettende Aktivitäten unterstützen, oder dem Schockzustand und der Todesangst entgegenwirken. Sie führt aber auch zu Blockaden, zum Wegtreten des Bewusstseins und ist längerfristig schädlich. Das Erlebnis kann Dissoziationen (teilweises Auseinanderfallen von normalerweise zusammenhängenden Funktionen der Wahrnehmung, des Bewusstseins, des Gedächtnisses, der Identität und der Motorik) sowie Gefühle der Entfremdung vom Geschehen (Derealisation und/oder Depersonalisation) hinterlassen und wird anschließend nicht mehr zusammenhängend (Amnesie) erinnert. Stresshormone docken im Gehirn vor allem in den gut miteinander vernetzten Bereichen der Amygdala, des Hippocampus und des mittleren Stirnhirns an, wodurch zugleich die emotionale Bewertung der Umweltreize, das Gedächtnis sowie die sprachliche Verarbeitung der Erlebnisse betroffen sind. Die Amygdala regelt über ihre starke Verknüpfung mit dem Hirnstamm auch die Anpassung der autonomen Funktionen des Körpers mit - wie Atmung und Kreislauf – an die jeweiligen Situation mit. Zum Hypothalamus als Zentrale des vegetativen Nervensystemsgibt es ebenfalls direkte Nervenverbindungen. Die Amygdala hängt zudem mit dem motorischen System und über sensorische Cortex-Areale mit dem Riechen, Schmecken, Sehen, Hören, Fühlen zusammen und ist dadurch an (Schreck-) Reflexen beteiligt.
Die traumatische Erfahrung ist aufgrund derartiger Phänomene der Übererregung im ZNS in ihrem eigentlichen Kernbereich meist abgespalten von der bewussten Persönlichkeit, und zwar vor allem vom verbalen und von logischem Denken. Sie wird sensomotorisch und bildhaft gespeichert. Deswegen sind Traumata mit verbaler Psychotherapie oder rein kognitive Therapiestrategien der Psychoanalyse und der Verhaltenstherapie nicht wirksam genug behandelbar. Sie bewirken nicht die notwendigen neurobiologischen Veränderungen (vgl. Meißner 2017). Der Einbezug von Emotionen, das Aufspüren von Ressourcen und das Einüben alternativer Schemata im Fühlen, Denken und Handeln sind demnach wichtig, da strukturelle Defizite im Gehirn mitbehandelt und neue Antwortmuster ausgeprägt werden.
Kombinierte psychische und körperliche Reaktionen
Traumafolgen sind durch verschiedene psychophysiologische Symptome in folgenden Bereichen gekennzeichnet (vgl. Fischer 1999, Berger, S. 672-673). Seit 2022 existiert im ICD 11 offieziell die Diagnose der Komplexen PTBS (nach einer Vielzahl von Traumatisierungen), bei der Störungen der Identität, der Affektregulation und Beziehunsschwierigkeiten:
- Hyperarousal: Charakteristisch sind gesteigerte psychophysische Erregungen – auch auf sog. Trigger (mit dem Trauma gekoppelte Reize) hin, wie z.B. Herzrasen, Schreckreaktionen, Angst- und Spannungszustände, Schlafstörungen, Alpträume, Konzentrationsstörungen.
- Intrusionen und Flashbacks:Nicht kontrollierbare Wiedererinnerungen an traumatische Situatiuonen, wobei bei Flashbacks sogar das Gefühl entsthet, als sei die traumatische Wiedererinnerung im Hier und Jetzt Realität
- Gedächtnis: Erinnerungslücken sind ebenso häufig wie ungewolltes, bildhaftes Wiedererleben von Teilen des Traumas (sog. Flashbacks oder Intrusionen).
- Gefühle: Gefühle von Empfindungslosigkeit bis hin zum gestörten Bezug zum eigenen Körper. Diese hinterlassen auch im Sozialleben Schwierigkeiten: Entfremdung, Einsamkeitserleben, Kontaktunwilligkeit oder emotionale Re-Inszenierung des Traumas.
- Vermeidung: Vermeidungsverhalten wird nach dem Trauma erlernt, um kurzfristig die Häufigkeit von Intrusionen zu vermeiden. Langfristig steigern sich die Ängste vor traumaassoziierten Situationen.
- Introjektionen: Intensive Scham- oder Schuldgefühle sind nicht selten. Abgewehrte Gefühle des Täters, die dieser selbst nicht erkennt oder erträgt, und die Gefühle des Opfers können während oder nach der Traumatisierung unbemerkt aneinander gebunden werden. Vergewaltigte z.B. übernehmen bestimmte Gefühle, insbesondere die Schuldgefühle des Täters (sog. Introjektionen). Dadurch leiden Opfer an Schuldgefühlen oder Scham, an denen eigentlich die Täter leiden müssten.
- Verlust von Vertrauen: Sowohl das Selbstvertrauen als auch das Vertrauen, das man in Andere setzt, sind betroffen. Bis hin zum Urvertrauen können Traumata verletzend wirken, wenn die Zuverlässigkeit sozialer Beziehungen generell angezweifelt wird.
Traumafolgestörungen benötigen sofortige soziale Unterstützung
Dauer, Intensität und Vielfalt der Symptome lassen kürzere, akute Belastungsreaktionen oder das länger andauernde Posttraumatische Belastungssyndrom (PTBS) oder sogar eine dissoziative Identitätsstörung voneinander unterscheiden (vgl. Dilling et al. 2012). PTBS wird häufig falsch eingeschätzt oder behandelt als Depression, Angst- oder Borderline-Störung, Psychose, oder es verbirgt sich hinter Essstörungen. Ein erhöhtes Risiko für traumatische Erkrankungen haben vor allem Menschen, die bereits traumatisch oder mit anderen psychischen Erkrankungen vorbelastet sind.
Für die Zeit nach einem Trauma gibt es weitere Risikofaktoren: Mangelnde soziale Unterstützung, fortgesetzte negative Lebensereignisse, mangelnde Anerkennung des Traumas durch Andere, sekundäre Stressfaktoren wie Umzug, Angst, finanzielle Probleme erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer PTBS. Wenn die akuten Reaktionen nicht innerhalb von vier Wochen abklingen, können die Traumafolgen chronifizieren und sogar persönliche und psychosoziale Ressourcen können sich verlieren (Sack 2013). Schon in den ersten Tagen und Wochen nach dem Erleben eines Traumas sind daher psychotherapeutische Maßnahmen als Kriseninterventionen sinnvoll. Treten länger andauernde Reaktionen auf, ist eine mehrstufige Behandlung erforderlich.
Körperpsychotherapie
Um langfristig und nachhaltig Trauma lösende, die Persönlichkeitsentwicklung fördernde Wirkungen in der Psychotherapie zu erzielen, ist es sinnvoll, nicht nur die Psyche, sondern auch den Körper (u.a. Fogel 2013, Wöller 2013, Marlock/Weiss 2006, Fischer ) und eventuelle Schädigungen des Körperbildes (Joraschky et al. 2009) unmittelbar in die Therapie einzubeziehen.
Es gibt neben Methoden wie Sport, Yoga, Entspannung, Massage, Physiotherapie, Feldenkrais-Methode, Eutonie, Atemtherapie u.v.a.m. diverse körperorientierte Verfahren, die den Körper auch im psychotherapeutischen Sinn ansprechen. Bekannt sind z.B. die analytische Körperpsychotherapie, die Bioenergetik, verschiedene Arten der Bewegungstherapie und die Tanz- und Ausdruckstherapie. Sie unterscheiden sich in der Art der Körperarbeit und in der Art, wie die therapeutische Beziehung gestaltet wird. Die meisten tanztherapeutischen Ansätze basieren zum einen auf dem Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts entstandenen Ausdruckstanz und den nachfolgenden tanzpädagogischen Ansätzen und zum anderen auf der humanistischen Psychotherapie. Diese stellt nicht die Vergangenheit und auch nicht die Krankheitssymptome in den Vordergrund sondern die prozesshafte ganzheitliche Weiterentwicklung des einzelnen Menschen (Individuation) und im Hier und Jetzt. Ressourcenstärkung sowie wertschätzende, empathische und authentische Kommunikation zur therapeutischen Beziehungsgestaltung stehen im Vordergrund (Maslow 1994, Rogers 2012).
Tanztherapie bei Traumata
Die Prozesse der Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche und Psyche und Körper, des sog. „bottom up“ (Hochkommen von Erinnerungen und Gefühlen aus dem Körper bzw. aus den Nervennetzwerken) und „top down“ (Wirkungsrichtung des Bewusstseins auf den Körper,) stehen aktuell im Fokus der Embodiment-Forschung (siehe Literaturliste unten z.B. Koch 2013; Fogel 2013; Fischer 2008, Marlock/Weiss 2006). Zu den besonderen Vorgehensweisen der tanztherapeutischen Arbeit bei traumatisierten Menschen liegen zahlreiche Veröffentlichungen vor. Nonverbale Elemente in der Psychotherapie können in allen Phasen einer Traumatherapie hilfreich sein. Sie ermöglichen sowohl die Stabilisierung (zusätzlich zum bekannten Sklilltraining) der traumatisierten Menschen als auch den Neuaufbau von Vertrauen in haltgebender Atmosphäre als auch den Zugang sowie die kontrollierte Bearbeitung und den Ausdruck von Erlebnissen, die (noch) nicht mit Sprache erreichbar oder auszudrücken sind. Es ist auf jeden Fall wesentlich die neuronalen Netzwerke zu erreichen, kennenzulernen und zu modulieren, in denen die Traumata abgespeichert sind. Sinneseindrücke und Körperwahrnehmungen sowie -reaktionen sind wesentlicher Teil dieser Netzwerke.
Ein Beispiel aus eigener Praxis: „Authentisches Atmen“ - Begegnung mit Gefühlen
Innerhalb einer klinischen tanztherapeutischen Gruppensituation kam eine traumatisierte Krebspatientin auf ihren Atem zu sprechen. Obwohl sie schon an Atemgymnastikstunden teilgenommen hatte, spürte sie ihren Atem überhaupt nicht. Während einer den freien Atemfluss fördernden Bewegungsübung, die auf dem shape flow-System von J.S. Kestenberg (1999) basierte, beschäftigte sie sich mit dem Thema des Öffnens und Schließens und bemerkte, dass beim Einatmen nichts in sie hinein käme, es ging aber auch beim Ausatmen nichts raus aus ihr. Sie wüsste sowieso nicht, wo die Luft bliebe. Sie fasste zusammen: „Ich habe keine Gefühle. Da ist nichts!“ Später nahm sie wahr, wie die Atemluft von außen durch ihre Nase einströmte und sich ihr Zwerchfell bewegte. Dabei lösten sich Gefühle von Traurigkeit und Hilflosigkeit. Sie weinte und äußerte erstmals auch verbal ihre Verzweiflung in der Gruppe (vgl. Löwenstein 2015).
Hier gibt die Förderung des von mir so benannten „authentischen Atemflusses“ unterdrückten oder unbewussten oder halbbewussten Emotionen einen deutlicheren Ausdruck. Den eigenen Atem zu beobachten und bewusst in allen seinen Qualitäten frei zu lassen (Rhythmus, Tiefe, Ort, Emotionalität etc.) macht nicht nur bei Atemwahrnehmungsübungen sondern auch innerhalb von rhythmischen Körperformungsprozessen die reziproke Interaktion von Körper und Psyche erfahrbar. Die Atmung selbst verbindet Bewusstsein und Unbewusstes miteinander. Bewegung, Körperformung und bewusstes Atmen beeinflussen sich im Laufe des gesamten Therapieprozesses gegenseitig. Im Laufe therapeutischer Gespräche können diese Wechselwirkungen bewusst bearbeitet und für den Alltag nutzbar gemacht werden. Therapeuten können daran mitwirken, den Erlebnissen mit neuen Gedanken und Entwicklungszielen zu begegnen und zu erarbeiten, was es aus den Traumatisierungen zu lernen gibt.
Positive Körpererfahrungen
Praktiken, die lediglich auf Sensibilisierung des Körpers aus sind, stellen für traumatisierte Menschen ein besonderes Risiko dar, da retraumatisierende aus dem Körper aufsteigende Erinnerungen oder Spaltungsprozesse vermehrt werden können. Die Aufmerksamkeit immer wieder auch nach außen auf die sinnliche Erfahrung der Realität zu richten, kann wiederum Schutz bieten. Sinnvoll ist auf jeden Fall, die Encodierung und Speicherung von relativierenden, positiven Körpererfahrungen zu unterstützen, so die Tanztherapeutin Marianne Eberhard Kaechele (s.u.: 2013, S. 594): „Die Stärkung ihrer psychophysischen Ressourcen kann viele Patientinnen in die Lage versetzen, die psychophysischen Folgen des Traumas ohne dauerhafte medikamentöse Eingriffe selbst regulieren zu können.“
Beziehungsförderung bei traumatisierten Menschen
Bewegte Gestaltungen in der Tanztherapie
Durch Körpersprache bringen wir Teile unserer Lebensgeschichte zum Ausdruck, indem wir Gedanken, Gefühlen und Willensimpulsen einen mehr oder weniger bewusst geformten Ausdruck verleihen. Jeder Mensch ist somit ein Tänzer. Diese Grundhaltung ist charakteristisch für Tanztherapeuten. Wie traumatisierte Menschen im tanztherapeutischen Rahmen behandelt werden können, ist das Thema dieses Artikels.
Beginn tanztherapeutischer Traumatherapie
Die tanztherapeutische Behandlung von traumatisierten Menschen beginnt mit der biografischen Anamnese, die zum einen im Gespräch und zum anderen über Bewegungsanalysen erfolgen kann. Die gängigsten Bewegungsanalyse-Systeme sind von dem Tänzer Rudolf von Laban (2003) sowie von der Psychoanalytikerin J.S. Kestenberg (sog. Kestenberg Movement Profile MP, 1999) entwickelt worden (vgl. Bender 2014).
Besondere therapeutische „Haltung“ gegenüber Traumatisierten
Therapeutische Prozesse werden immer durch die Person des Therapeuten mitbeeinflusst. Im Rahmen einer Tanztherapie wirkt das Miteinander als bewegtes und bewegendes Gespräch, als Beziehung zu sich selbst, zur Therapeutin und zu anderen. Von Anfang an geht es darum, die therapeutische Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen und als Arbeitsbündnis zu etablieren. Traumatherapeuten sind hier besonders gefordert: „Wichtig werden dabei eine entwicklungsfördernde Beziehungsgestaltung und die Verschiebung des Fokus auf intersubjektive Prozesse. Intention und Haltung rücken dabei in den Vordergrund, die Gesprächsatmosphäre wird wichtiger als der kognitive Gehalt an Deutung und Einsicht“ (Meißner 2017). Demzufolge brauchen traumatisierte Menschen für ihre Fortschritte konkrete Beziehungen, sie brauchen es, „sich im Anderen weiterzuentwickeln“.
Auch Fischer (1999) stellt bei Behandlungen traumatisierter Menschen die Rolle des Therapeuten in den Vordergund. Er empfiehlt Traumtherapeuten eine lebendige innere Reaktionsbereitschaft sowie persönliches Engagement, Interesse und Empathie für die Opfer auszuprägen. Eine zentrale Regel laute: „Neutraliät nein, Abstinenz ja“. Denn ein „neutrales“ beobachtendes Verhalten des Therapeuten - wie sie üblicher Weise z.B. bei Psychoanalysen vorgesehen ist - kann ursprüngliche Traumata vertiefen, was insbesondere bei zwischenmenschlichen Desorientierungstraumata unmittelbar nachvollziehbar ist. Mit Abstinenz ist eine nicht-beurteilende innere und äußere Haltung gemeint, ein Verzicht auf egoistische Anliegen und Bedürfnisse dem Opfer gegenüber. Therapeuten dürfen sich z. B. grundsätzlich nicht mit ihren Patienten privat anfreunden, sie womöglich in eigenen Ausbildungsgruppen zulassen oder von ihnen Zeit oder Aufmerksamkeit für ihre persönlichen Probleme verlangen. Leider wird dieses Gebot sogar auch auf sexuellem Gebiet immer noch häufig verletzt, womit den Patienten großer Schaden zugefügt wird (vgl. Schleu 2014). Das traumatherapeutische Setting sollte ganz bewusst nach den Gesichtspunkten
- der einfühlsamen Kooperation
- der Transparenz und
- der Gleichrangigkeit, Gleichmächtigkeit
gestaltet werden (vgl. Fischer 1999). PatientInnen, die in der Kindheit unter autoritären Beziehungen mit starker Betonung des Machtgefälles gelitten haben, brauchen die gleichrangige Beziehungserfahrung als Korrektiv. Hebt sich die therapeutische Beziehung nicht genügend von machtvollen Vorerfahrungen ab, so werden inhaltliche Äußerungen, therapeutische Techniken und Übungen schon im Voraus mit früheren Verletzungen vermischt. Vorsicht ist aus diesem Grund auch mit suggestiven Einflüssen oder Heilsversprechungen geboten. Bewusstsein für diese Punkte nutzt jedem Therapeuten, der mit traumatisierten Menschen zu tun hat, z.B. auch mehr somatisch orientierten Heilpraktikern. Um Transparenz zu stärken, hilft auch eine Kooperation derjenigen Therapeuten, die mit dem traumatisierten Patienten zu tun haben, untereinander, wenn diese vom Betroffenen gewünscht ist.
Für Körperpsychotherapeuten sind die von G. Fischer formulierten Regeln besonders bedeutsam, da sie sich mit ihrem eigenen Körper als Werkzeug voll und ganz in die therapeutische Beziehung einbringen und damit bis in die Gesten, Handlungen und Bewegungen hinein als Vorbild oder Ausdruck/Verkörperung für Transparenz, Gleichrangigkeit und Einfühlsamkeit und damit als Korrektiv wirken können. Sie sollten auch beim Erkennen spezifischer Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse, die zu Opfer- oder Täterverhalten verführen können, besonders aufmerksam sein. Denn Rollen-Re-Inszenierungen können ihre manipulativen Wirkungen bis in die Körpersprache hinein entfalten. Meine Erfahrung ist, dass sich durch bewusstes Arbeiten am Atem- und Formenfluss des Körpers – u. z. sowohl von der Therapeutin als auch von der Patientin – die therapeutische Situation bewusster einschätzen lässt und eine von Aufmerksamkeit, Sicherheit, Halt und Vertrauen geprägte Atmosphäre im Miteinander - also von beiden Seiten aus - schaffen lässt (Löwenstein 2015).
Körperformung fördert die emotionale Kommunikation
Grundlage für die Arbeit mit der Körpersprache innerhalb eines tanztherapeutischen Traumasettings, speziell für die Arbeit mit dem Atem- und Formenfluss, bietet das sog. Kestenberg Movement Profile (KMP I und II, Kestenberg 1999). Es beschreibt die Bedeutung und die Entwicklung von Bewegung und komplexen Bewegungsmustern im Laufe des Lebens. Beim KMP I geht es zum einen um den „tension flow“ (Spannungsfluss) in allen Körperteilen. Dieser hängt mit der Eigenregulation von Affekten und Trieben zusammen. Änderungen der Körperformen „shape flow“- „shaping“ (Formenfluss – Formung, KMP II) ergänzen den Spannungsfluss und spielen bei der emotionalen Kommunikation, also beim Austausch von Gefühlen in Beziehung, eine Rolle. Dem Formenfluss liegt der Atemrhythmus als Kernmechanismus zugrunde. Alle Ausdrucksbewegungen in Körperteilen, Rumpf und Gesicht basieren auf Ableitungen oder auf dem direkten Ausdruck von Veränderungen im Atemfluss. In Abfolgen von mit Einatmen verbundenen Wachsen, das heißt Öffnen (growing), und Schrumpfen/Schließen (shrinking) beim Ausatmen zeigen sich kontaktfördernde und kontaktablehnende Bewegungsmuster. Kestenberg erforschte diese rhythmischen Änderungen der Körperformen an Kindern innerhalb der Mutter-Kind-Beziehung (Kestenberg 1991). Frühzeitig arbeitete sie auch mit Holocaust-Überlebenden.
Als Fallbeispiel sei eine Improvisation zum Thema „Wachsen“ und „Schrumpfen“ in einer tanztherapeutischen Gruppe beschrieben. Eine Patientin sucht Unterstützung, Schutz, sie äußerte in vorhergehenden Stunden verbal ihr Bedürfnisse nach „Last-Loswerden-wollen“, Halt, Wärme und Harmonie. In dieser Stunde tanzt sie mit einem Pezzi-Ball. Sie stemmt diesen angestrengt wie ein Gewichtheber in die Luft, bis sie nicht mehr kann. Ausatmend legt sie den Ball auf die Erde ab und setzt dann sofort zur Wiederholung der wachsenden Aufwärtsbewegung an. Erst als sei ihren Atem bewusster erlebt, ist sie in der Lage, sich bei der Abwärts-Bewegung dem Ball anzuvertrauen. Sie zögert aber, ihr Gewicht dorthin abzugeben. Nach einer Nachfrage von mir „Wohin tendiert die Atmung und wohin tendiert die Bewegung?“ lässt sie sich mit dem Bauch auf den Ball sinken und schmiegt sich an diesen an. Sie bleibt entspannt dort liegen und wiegt sich auf dem Ball hin und her. Sich die beruhigende Schaukelbewegung und das Tragen-Lassen zu genehmigen, tut ihr gut. Im weiteren Verlauf der Therapie reduziert sich Ihre Angst vor Schwäche und vor der Erde. In der letzten Stunde tanzt sie wie eine Katze. Das Tier fasziniert sie, weil es sowohl aktiv frei und unabhängig als auch Haustier ist, das faul sein und behütet werden kann. Als Katze bewegt sie sich raumgreifender mit wechselnder Bewegungsdynamik. Sie tanzt zwar scheinbar regrediert in der unteren Raumebene, wirkt dabei aber nicht mehr so erschöpft wie zu Beginn der Therapie. Sie ist erfreut, dass sie frei wählen kann zwischen Nähe, Geborgenheit und Unabhängigkeit in der Gruppe. In Zukunft will sie freier leben, nicht mehr so abhängig.
Adjustment und clashes
Im Formenfluss und Atemrhythmus wird auch ein dynamisches, wechselseitiges und aktives Aneinander-Angleichen und Aufeinander-Eingehen von Beziehungspartnern sichtbar. J.S. Kestenberg definierte diese aktive Anpassung in Bewegung als „adjustment“. Aus Kestenbergs Sicht stellt diese Fähigkeit, die schon zwischen Mutter und Säugling zum Ausdruck kommt, die Grundlage für das Urvertrauen dar. Widersprüche zeigen den Verlust von Vertrauen an. Schon beim vier Wochen alten Säugling gehört es zu den Copingmechanismen dass er auf angenehme Reize mit Hinwenden/Öffnen und bei unangenehmen Reizen reagiert, u.z. mit Zusammenschrumpfen und Abwenden (Flucht) oder Treten mit Händen und Füßen (Kampf ), ins Leere schauen oder einschlafen (Verleugnung), schreien oder Wimmern (Protest, Verzweiflung). Bei doppeldeutigen Botschaften entstehen Konflikte, "clashes". Diese können schon beim Kind - aber auch in späteren Entwicklungsphasen, nämlich zum Beispiel durch Beziehungstraumata - zu Gefühlen der Verbindungslosigkeit, Selbstzweifeln und mangelndem Vertrauen auf Unterstützung führen. Langzeit-Konflikte können (nicht nur beim Kind) in eine ständig "geschrumpfte" Körperhaltung oder in einer generellen Neigung zu verschlossenen Gesten oder Haltung münden (vgl. auch Keleman 1999). Über den Weg aufeinander eingehender Bewegungsformung im Miteinander ist im therapeutischen Setting „nachholende“ Ich-Entwicklung sogar in puncto Urvertrauen möglich. Innerhalb der Körperpsychotherapie fördern gemeinsame bewusst initiierte öffnende und schießende Bewegungen im rhythmischen Wechsel Prozesse des adjustments oder von „clashes“. Auch Selbstvertrauen dem eigenen Körper gegenüber und Vertrauen innerhalb der therapeutischen Beziehung lassen sich thematisieren und wiederlernen. Derartige bewegte Erfahrungen können Ich-stärkend wirken, die therapeutische Allianz und andere Beziehungen stabilisieren und sich sogar neurobiologisch positiv auswirken (Meißner 2017).
Zentrale Phasen tanztherapeutischer Traumatherapie
Nach der Diagnose einer Traumafolgestörung ist es wichtig, die Betroffenen über die Natur und die Dynamik traumatischer Reaktionen und Symptome sowie über die geplante Therapie und Behandlungsalternativen sorgfältig aufzuklären. Für die ressourcenstärkende traumaadaptierte Therapie, wie es auch die Tanztherapie sein kann, werden von L. Reddemann (2001) drei aufeinander folgende Phasen empfohlen, die nach meinen tanztherapeutischen Erfahrungen „wellenförmig“, rhythmisch auch innerhalb einer Therapiestunde wechseln können, ineinander greifen und sich gegenseitig ergänzen können (Löwenstein 2015).
Stabilisierung
In der sogenannten Stabilisierungsphase, geht es darum, innere Sicherheit zu erleben, innere Stabilität neu zu erlernen, was aber mit „neutralen“ Techniken ohne Sinn für die therapeutische Beziehung alleine nicht möglich ist. Wichtig ist, dass im Alltag kein Täterkontakt mehr besteht. Falls dies nicht gewährleistet ist, dient diese Phase der Therapie primär dazu, tatsächliche äußere Sicherheit, das heißt unbedingten Abstand, vom Täter zu erreichen. Typische Stabilisierungsmöglichkeiten sind einfache Übungen in Bewegung oder Imaginationstechniken (vgl. auch Fischer 2008). Schon häufig habe ich erlebt, dass PatientInnen das Bedürfnis hatten, sich im Rahmen der Therapiestunden sichere Plätze zu „bauen“, z. B. mit Decken, Kissen, Stäben, Igelbällen, Bändern etc. Auf diesem Weg werden Bedürfnsisse Ruhe und Abgrenzung sinnlich dargestellt und spürbar. Auch der Körper selbst sollte als sicherer Ort wiederentdeckt werden, indem z. B. Körperteile gefunden werden, die gerne bewegt werden. Der bewusste Umgang mit dem eigenen Bewegungsrepertoire, mit den Faktoren Raum, Zeit oder Gewicht kann in Bewegung so gefördert werden, dass Kontrolle oder Spannungsabbau und Entspannung einzelner Körperteile oder des ganzen Körpers erfahren werden. Als Grundelemente der Bewegung können z.B. fließende und gehaltene, leichte und kräftige, kleine und große Bewegungen gemeinsam erprobt werden sowie öffnende und schließende Bewegungen aus dem KMP II. Betroffene können darauf achten, körperlichen Blockaden zu erkennen und evtl. selbstbestimmt und kontrolliert abzubauen, „aufzutauen“. Zeitgleich mit dem Erleben und Wahrnehmen des Körpers und der Bewegungen kann in wohldosierter Weise das Wahrnehmen der Gefühle und Gedanken angeregt werden.
Im Falle von Orientierungstraumata kann die stabilisierende Phase Patienten helfen, ihr eigenes Wertesystem zu schätzen und zu vertreten, was in Form von Rollenspielen geübt werden kann. Derartige Themen, auch spirituelle und religiöse Themen direkt anzusprechen und in die Therapie einzubeziehen, dazu will auch ein aktuelles Positionspapier der DGPPN Psychotherapeuten explizit anregen (Utsch et al 2016). Bei körperorientierten Therapien geht es in diesem Zusammenhang auch um individuelle Vorstellungen und Einschätzungen der Bedeutung des Körpers. Denn das Ineinandergreifen körperlicher, seelischer und geistiger Erfahrungen wird je nach kulturellem Hintergrund und je nach religiösen oder spirituellen Überzeugungen der Patienten und auch der Therapeuten jeweils unterschiedlich bewertet. Ein vielen Sittenregeln unterworfener „Zeugen Jehovas“ bewertet seinen Körper und der eigenen Erlebnisse mit dem Körper anders als beispielsweise ein Buddhist, der sich damit beschäftigt, den Kreislauf von Wiedergeburten im Körper zu verlassen.
Konfrontation/Exposition in sensu
Bei der Therapie von PTBS sieht die S3-Leitlinie vor, „mittels Konfrontation mit dern Erinnerung an das auslösende Thema das Ziel der Integration unter geschützten therapeutischen Bedingungen“ zu erreichen. Denn bei einigen Menschen reicht die Stabilisierungsphase nicht aus, um traumatische Symptome zu bewältigen. Trauma-Exposition ist aber nicht in allen Fällen und schon gar nicht zwingend notwendig. Insbesondere bei affektinstabilen oder autoaggressiven Personen, bei Suchtmittelkonsum, bei stark dissozierenden oder psychotischen bei psychosozial und körperlich stark belasteten Patienten und unbedingt bei anhaltendem Täterkontakt rät die Leitlinie selbst von der Bearbeitung traumatisch fixierter Erinnerungen und deren sensorischer Fragmente ab (Awmf 2011).Um mit dem Trauma verbundene Gewohnheiten und neuronale Muster nicht noch weiter zu verstärken, sollten Betroffene sich nicht allein und nicht wiederholt mit vergangenen traumatischen Situationen beschäftigen. In sorgfältig erwogenen Fällen kann es in der Therapie heilsam sein, zentralen Teilen eines Traumas wieder zu begegnen, zum Beispiel indem die Bilder des Unglücks, der Gewalttat oder der Beziehungswirrnisse bewusst zugelassen werden, soweit dies möglich ist. Ziel solcher Expositionen ist es, Dissoziationen zu überwinden, indem versprengt abgelegte Teile von Traumata, also Bilder, Sinneseindrücke, Gefühle, Gerüche, Körperwahrnehmungen oder Überzeugungen miteinander zu verbinden und es dem Gehirn möglich zu machen, diese als zusammengehörige Informationen wie in einem "alten Film" abzuspeichern und als Vergangenheit zu archivieren. Diese Phase kann z.T. in Bewegung stattfinden und mit entsprechenden Übungen vorbereitet werden. Es kann auch hilfreich sein, vorher neue Lösungsmöglichkeiten anzubieten und auszuprobieren, z. B. Ohnmachtssituationen durch Handlungen wie befreiende Gegenwehr zu überwinden.
Oft findet Traumakonfrontation auch spontan ungewollt und ausschnittsweise im Rahmen von Therapiestunden statt: Eine sexuell traumatisierte Frau thematisierte nach einigen kräftigenden und dehnenden Bewegungsübungen mit den Beinen, dass sie aktuell und auch im Alltag unter chronischen Schmerzen und hoher Anspannung in beiden Oberschenkeln litt. Sie spürte diese Spannungen sogar im Sitzen. Seit Jahren mied sie deswegen sogar Spaziergänge. Sie fühlte nun, dass mit den Schmerzen und Spannungen Wut und Ängste festhielt, was sie sehr ermüdete. Sie sprach nur andeutungsweise ohne Details über einige Erinnerungen aus ihrer Kindheit. Danach war es ihr allerdings möglich wieder mehr Freude am eigenen Körper und an Bewegung, sogar am Wandern, zu empfinden. Wichtiger als das Eintauchen in die Vergangenheit war für diese Patientin die Bewältigung der Gegenwart und die Orientierung in Richtung Zukunft.
Psychische Themen, wie Nähe-Distanz-Regulierung, Gleichgewicht, Umgang mit Gefühlen, Macht und Ohnmacht werden durch körperpsychotherapeutische Interventionen zugänglich. Tauchen traumatische Erlebnisinhalte auf, werden sie einfühlsam in Bewegung oder im Gespräch bearbeitet. Nur bewusst Wahrgenommenes kann anschließend bestenfalls selbstbestimmt ins Leben integriert oder mit Entschlossenheit wieder losgelassen werden.
Integration
In der dritten Phase geht es um das Einordnen traumatischer Erlebnisse in die persönliche Lebensgeschichte. Die Aufgabe in dieser Phase ist, das Trauma als Vergangenheit bewerten und dieses als Teil des eigenen Lebens akzeptieren zu lernen. Fragen nach angemessenen Gefühlen und Handlungen wie zum Beispiel nach angemessener Wut dem Täter gegenüber oder nach Trauer über das Geschehene und nach Wünschen, von denen man sich evtl. verabschieden muss, beispielsweise, wenn man Fähigkeiten nach einem Unfall endgültig verloren hat, werden bewegt. Folgende Fragen rücken in den Vordergrund: Was soll bleiben, was will ich verändern, was will ich neu gestalten? Neue Perspektiven können deutlich werden. Bestenfalls können Traumata jetzt sogar als Anlass gebend für ganz neue und gesundheitsfördernde Schritte der Ich-Entwicklungen empfunden werden. Wenn – wie ich es miterlebt habe - eine schwer traumatisierte frühberentete Frau nach jahrelanger psychiatrischer, psychotherapeutischer klinischer wie ambulanter Behandlungen in multiprofessionellen Teams (phasenweise mit körperpsychotherapeutischer Beteiligung v.a. zum Aufbau von Selbstvertrauen) in der Lage ist, gegen eine schädigende Institution vorzugehen, von dieser finanzielle Entschädigung für ihre Traumatisierung zu erstreiten, anschließend mit dem Geld eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme zu beginnen, dann gibt sie ein Beispiel für Neuorientierung trotz und nach vielschichtigen Traumata. Gelungene Integration traumatischer Erfahrungen tragen nach G. Fischer (1999) sogar dazu bei, dass neue positive Charakterzüge entwickelt werden, oder dass andauerndes soziales Engagement möglich wird, oder/und dass ein Bewusstsein dafür entsteht, dass die Transformation von Traumata ein lebenslanger Prozess sein kann. Traumata können dazu anregen, zwischenmenschliche Beziehungen bewusster zu erleben, und sie zunehmend freier zu gestalten.
Literaturliste der im Text zitierten Quellen:
Awmf (2011): Leitlinien-Detailansicht Posttraumatische Belastungsstörung http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/051-010.html, abgerufen am 26.3.2017
Bender, S. (2014): Die psychophysische Bedeutung der Bewegung. Ein Handbuch der Laban Bewegungsanalyse und des Kestenberg Movement Profiles, 3. überarb. Aufl. Logos Verlag Berlin
Berger, M. (Hrsg.) (2009): Psychische Erkrankungen. Klinik und Therapie. Urban & Fischer, Karlsruhe
BTD (Hrsg.) (2015): Liste der Forschungsarbeiten zur Tanztherapie, zusammengestellt von Iris Bräuninger. In: http://www.btd-tanztherapie.de/pdf_oeffentlich/TT_Forschungsergebnisse.pdf, 26.2.2017
Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M. H. (2012): Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD 10 Kapitel V (F). Huber, Bern
Eberhard-Kaechele, M. (2013): Wie das Kaninchen vor der Schlange. Körper und Bewegungsinterventionen bei traumatisierten Menschen. In: Wöller, W.: Trauma und Persönlichkeitsstörungen, Schattauer, Stuttgart
Egger, J.W. (2008): Das biopsychosoziale Krankheitsmodell in der Praxis. Der lange Weg von der Psychosomatik zur aktuellen biopsychosozialen Medizin. http://www.dgvt-fortbildung.de/interaktive-fortbildung/archiv-der-fachartikel/archiv/egger-jw-2008-das-biopsychosoziale-krankheitsmodell-in-der-praxis, abgerufen am 20.2.2017
Fischer, G. (2008): Neue Wege aus dem Trauma. Erste Hilfe bei schweren seelischen Belastungen. Patmos, Düsseldorf
Fischer, G, Riedesser, P. (1999): Lehrbuch der Psychotraumatologie. Ernst Reinhardt Verlag, München.
Förstl, H., Hautzinger, M., Roth, G. (Hrsg.) (2006): Neurobiologie psychischer Störungen. Springer Medizin Verlag, Heidelberg
Fogel, A. (2013): Selbstwahrnehmung und Embodiment in der Körperpsychotherapie. Vom Körpergefühl zur Kognition. Schattauer, Stuttgart
Joraschky, P., Loew, T., Röhricht, F. (2009). Körpererleben und Körperbild. Schattauer, Stuttgart
Keleman, S. (1999): Verkörperte Gefühle: Der anatomische Ursprung unserer Erfahrungen und Einstellungen. Kösel, München
Kestenberg, J.S., Kestenberg Amighi, J. (1991): Kinder zeigen, was sie brauchen. Verlag Anton Puster, Salzburg
Kestenberg, J.S., Loman, S., Lewis, P., Sossin, K.M. (1999): The meaning of movement. Routledge, New York
Koch, S. C. (2013): Embodiment. Der Einfluss von Eigenbewegung auf Affekt, Einstellung und Kognition. 2. Aufl. Logos, Berlin
Laban, R.v. (2003): Die Kunst der Bewegung. 3. Aufl. Florian Noelzel, Wilhelmshaven
Löwenstein, K. (2014): Meditation im Alltag. Die Kunst, Empathie und Yoga zu verbinden. Books on Demand, Bad Honnef
Löwenstein, K. (2015): Atem und Bewegung als formgebende Kräfte in der Psychotherapie bei Krebs. Akademiker Verlag, Saarbrücken
Marlock, G., Weiss, H. (Hrsg.) (2006): Handbuch der Körperpsychotherapie. Schattauer, Stuttgart
Meißner, A. (2017): Psychotherapeutische Wirkfaktoren. Emotionen sind für den Therapieerfolg wichtiger als Einsicht und Deutung. In: Neurotransmitter 28 (2), Springer Verlag, Berlin
Rogers, C. R. (2012): Therapeut und Klient. 21. Aufl. Fischer, Frankfurt/M.
Sack, M., Gromes, B.: Ressourcenorientierte Behandlungsstrategien in der Traumatherapie. In: Psychotherapie im Dialog 1/2013. Thieme Verlag, Stuttgart.
Schleu, A., Schreiber-Willnow, K., Wöller, W. (Hrsg.) 2014: Verwickeln und Entwickeln: Ethische Fragen in der Psychotherapie, VAS Bad Homburg
Reddemann, L. (2001): Imagination als heilsame Kraft. Zur Behandlung von Traumafolgen mit ressourcenorientierten Verfahren. Pfeiffer bei Klett-Cotta, Stuttgart
Rogers, C. R. (2012): Therapeut und Klient. 21. Aufl. Fischer, Frankfurt/M.
Utsch, M., Anderssen-Reuster, U., Frick, E., Gross, W., Murken, S., Schouler-Ocak, M., Stolz-Ingenlath, G . (2016): Empfehlungen zum Umgang mit Religiosität und Spiritualität in Psychiatrie und Psychotherapie. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), Berlin. Positionspapier vom 19.12.2016